In der elektronischen Patientenakte (ePA) werden Ihre medizinischen Daten und Befunde gespeichert. Die Digitalisierung und zentrale Ablage der Informationen soll Ärzten den Zugriff auf die Daten erleichtern und die Behandlung verbessern. Welche Vor- und Nachteile die elektronischen Patientenakte hat, erfahren Sie hier.
(Der gesamte folgende Text wurde von unserer Redakteurin ohne den Einsatz von KI geschrieben)
Elektronische Patientenakte – Bedeutung und Hintergrund
Diagnosen, Befunde, Medikationspläne, Therapiemaßnahmen, Notfalldaten, Impfpässe – im Laufe des Lebens fallen eine Menge Gesundheitsdaten an. Bislang lagen die Informationen getrennt voneinander in den Praxen niedergelassener Ärzte, in Krankenhäusern und Apotheken, oft noch in Papierform.
Gut organisierte Patienten haben sich Kopien ausdrucken lassen und diese in einem eigenen Ordner gesammelt. Die elektronische Patientenakte soll das alles vereinfachen – durch die Digitalisierung sämtlicher Dokumente und ihre Ablage an einem zentralen Speicherort in der Cloud. Über die Telematikinfrastruktur, das vom öffentlichen Internet getrennte Datennetzwerk des Gesundheitswesens, haben medizinische Einrichtungen Zugriff auf Ihre Gesundheitsdaten.
Die ePA ist Bestandteil des „Gesetzes zur Beschleunigung der Digitalisierung des Gesundheitswesens“, kurz Digital-Gesetz (DigiG). Der Deutsche Bundestag hat es am 14. Dezember 2023 verabschiedet, um den Versorgungs- und Behandlungsalltag für Patienten und Ärzte zu verbessern.
Wie läuft die Einführung der ePA ab?
Die schrittweise Einführung der ePA begann am 1. Januar 2021. Ab diesem Zeitpunkt konnten Krankenkassen ihren Versicherten eine App zum Hochladen ihrer medizinischen Daten anbieten. Parallel begann die Testphase in einigen Arztpraxen. Die Prozesssteuerung und Entwicklung der elektronischen Patientenakte erfolgt durch die gematik GmbH (Gesellschaft für Telematik im Gesundheitswesen), die nationale Agentur für Digitale Medizin. Sie ist im Besitz des Bundesgesundheitsministeriums sowie der Kostenträger und Leistungserbringer (Krankenkassen, ärztliche Vereinigungen, Krankenhausgesellschaften etc.). Das Projekt ePA ist also eine staatliche Initiative unter Beteiligung der Akteure im Gesundheitswesen.
Nach der Testphase erfolgt seit 15. Januar 2025 die flächendeckende Einführung der elektronischen Patientenakte, die sogenannte ePA für alle. Seither gilt anstelle der proaktiven Beantragung der ePA durch die Versicherten das Widerspruchsrecht: Wer keine ePA möchte, muss bei seiner Krankenkasse widersprechen, ansonsten bekommt er automatisch eine.
Auf Seiten der Gesundheitseinrichtungen erfolgt eine Einführungsphase der ePA in bestimmten Modellregionen, dazu zählen unter anderem Nordrhein-Westfalen und Hamburg. Bewährt sich die elektronische Patientenakte in rund 300 ausgewählten Einrichtungen soll sie bundesweit in Arztpraxen, Krankenhäusern und Apotheken zum Einsatz kommen. Das soll ab Frühjahr 2025 der Fall sein.
Vorsorgen für den Pflegefall
Das Projekt elektronische Patientenakte mag gelingen, auf der Kippe steht dagegen die Pflegeversicherung. Die Deckungslücke bei den Pflegekosten wird größer, Sie zahlen immer mehr aus eigener Tasche. Sorgen Sie deshalb vor und schließen Sie eine Pflegezusatzversicherung ab. So müssen Sie oder Ihre Angehörigen später nicht die gesamten Ersparnisse für Ihre Pflege aufwenden.
Vorsorgen für den Pflegefall
Das Projekt elektronische Patientenakte mag gelingen, auf der Kippe steht dagegen die Pflegeversicherung. Die Deckungslücke bei den Pflegekosten wird größer, Sie zahlen immer mehr aus eigener Tasche. Sorgen Sie deshalb vor und schließen Sie eine Pflegezusatzversicherung ab. So müssen Sie oder Ihre Angehörigen später nicht die gesamten Ersparnisse für Ihre Pflege aufwenden.
Für wen gibt es die ePA?
Die Resonanz der Versicherten auf die ePA war nach ihrer Einführung 2021 sehr gering. Gerade einmal ein Prozent entschied sich für eine Nutzung der App. Um die Verbreitung anzukurbeln, entschied sich der Gesetzgeber zu einer Opt-out-Regelung. Das heißt, jeder bei einer gesetzlichen Krankenkasse Versicherte, der keinen Widerspruch einlegt, bekommt automatisch eine ePA. Private Krankenkassen können eine ePA anbieten, müssen es aber nicht.
Welche Daten werden in der ePA gespeichert?
In der elektronischen Patientenakte lassen sich grundsätzlich alle Arten von Gesundheitsdaten speichern, auch durch den Patienten selbst angelegte. Nicht alle funktionieren sofort nach der Einführung, sollen aber schrittweise in die digitale Akte einpflegbar sein.
Als erstes soll ab Januar 2025 die Medikationsliste auf Basis der eingelösten E-Rezepte automatisch in der elektronischen Akte erscheinen, ebenso die Abrechnungsdaten der Krankenkasse.
Die ePA kann unter anderem folgende Informationen enthalten:
- Notfalldaten
- E-Rezepte
- Arztbriefe
- Bildaufnahmen (Röntgen, MRT etc.)
- Laborwerte
- Befunde
- Medikationspläne
- OP-Berichte
- Impfpässe
- Mutterpässe
- U-Hefte
- Zahnarztbonushefte
- Schmerz- und Blutdrucktagebücher
- Ernährungspläne

Diese Daten übertragen entweder Sie selbst oder berechtigte Ärzte, Therapeuten, Apotheken und Krankenhäuser in Ihre elektronische Patientenakte. Papierdokumente lassen sich dabei mit dem Handy abfotografieren und hochladen.
Wichtig zu wissen: Die ePA ersetzt nicht die Patientenakte beim Arzt. Diese muss weiterhin in der Praxissoftware gespeichert und gepflegt werden. Es muss auch ohne ePA eine lückenlose medizinische Dokumentation gewährleistet sein.
Wer hat Zugriff auf die ePA und wie funktioniert die Nutzung?
Der Zugriff auf die ePA ist so geregelt, dass die Datenhoheit stets beim Patienten bleibt. Das heißt, Sie können nicht nur gegen die gesamte elektronische Patientenakte Widerspruch einlegen, sondern auch einzelne Berechtigungen für die Einsicht der Daten erteilen bzw. verweigern. Ihr Arzt befüllt die elektronische Akte also nicht automatisch, sondern nur mit Ihrer Zustimmung. Möchten Sie keine Speicherung, soll ein Hinweis im Arztgespräch genügen.
Auch für die Dateneinsicht bedarf es Ihrer Zustimmung. Die inhaltliche und zeitliche Zugriffsverwaltung erfolgt über die ePA-App, die Versicherte auf einem mobilen Endgerät (Smartphone oder Tablet) installieren müssen. Für den Zugang benötigen Sie Ihre elektronische Gesundheitskarte (eGK) und eine persönliche Identifikationsnummer (PIN). Über die App können Sie auch jederzeit Daten löschen.
Besitzen Sie kein Smartphone oder trauen sich den Umgang mit der App nicht zu, können Sie sich an die Arztpraxis bzw. an die Ombudsstelle der Krankenkasse wenden. Oder Sie beauftragen einen Angehörigen damit, die App in Ihrem Namen zu nutzen.
Unabhängig von Ihren Vorgaben, ist der Personenkreis mit Zugriffsrecht gesetzlich eingeschränkt. Befugt ist nur medizinisches Personal, die Krankenkassen dürfen Ihre ePA nicht einsehen. Haben Sie beispielsweise Ihrem Hausarzt Zugang zu den Informationen gewährt, greift dieser über sein Praxisverwaltungssystem auf Ihre ePA zu. Dafür braucht er seinerseits einen Ausweis und eine PIN.

Was sind die Vor- und Nachteile der elektronischen Patientenakte?
Versicherte sollten die Vor- und Nachteile der ePA kennen, bevor Sie sich dafür oder dagegen entscheiden. Zu berücksichtigen sind hier auch die Bewertungen unabhängiger Stellen wie Verbraucherverbände und IT-Experten.
Eine Entscheidungshilfe im Überblick:
| Vorteile der ePA | Nachteile der ePA |
|---|---|
| zentrale Speicherung aller relevanten Daten | Risiko, dass Daten gehackt werden und in falsche Hände geraten |
| keine Eigenverwaltung von Papierdokumenten, Befunden auf Datenträgern etc. | mögliche Zugriffseinschränkungen bei technischen Störungen der Infrastruktur |
| Vermeidung teurer Doppeluntersuchungen | Menschen ohne Endgerät für die App sind bei der Nutzung auf Dritte angewiesen |
| weniger Wechselwirkungen von Medikamenten durch den Medikationsplan | Für die Sicherheit des Endgeräts ist der Nutzer zuständig |
| besserer Austausch medizinischer Einrichtungen | Zugriffseinschränkungen müssen aktiv durch den Versicherten erfolgen |
| effizientere Therapien und einfachere Notfallversorgung | Ärzte können nicht auf die Vollständigkeit der ePA vertrauen |
| Vordiagnosen könnten die Objektivität der Mediziner beeinträchtigen | |
| mögliche Stigmatisierung Kranker |
Insbesondere der Punkt „aktive Zugriffsverwaltung“ sollte jedem Anwender der ePA bewusst sein. Wer sich nicht darum kümmert, gibt bei jedem Einstecken seiner Gesundheitskarte in ein Lesegerät seine Gesundheitsdaten zur Einsicht frei – auch in der Apotheke!
Widerspruch gegen die ePA einlegen – so geht’s
In den letzten Wochen des Jahres 2024 und Anfang 2025 haben viele Versicherte Post von Ihrer Krankenkasse bekommen. Das Schreiben enthält die Aufklärung über das Widerspruchsrecht zur ePA und das Prozedere. Gesetzlich darf die Kasse keinen bestimmten Kommunikationsweg vorschreiben, oft werde jedoch nicht auf die Möglichkeit eines telefonischen Widerspruchs hingewiesen, kritisiert der Verbraucherzentrale-Bundesverband. Sie können also von Gesetzes wegen schriftlich, online oder per Telefon widersprechen. Minderjährige können selbst gegen die ePA Widerspruch einlegen, wenn sie das 15. Lebensjahr vollendet haben. Vorher liegt das Recht bei den Eltern.
Wer die in den Schreiben angegebene, sechswöchige Frist verpasst, kann auch später noch jederzeit der ePA widersprechen und sie von seiner Krankenkasse löschen lassen. Im Zuge Ihres Widerspruchsrechts können Sie auch die Verwendung Ihrer anonymisierten Gesundheitsdaten zu medizinischen Forschungszwecken ablehnen.
Plan und Wirklichkeit – wie sind die Aussichten?
Die Pläne der Bundesregierung für die flächendeckende Einführung der ePA 2025 sind äußerst ambitioniert. Inwieweit das gelingt und alles reibungslos funktioniert, wird sich im Laufe des Jahres herausstellen. Die Arztpraxen müssen die ePA implementieren, alles muss datenschutzkonform und sicher sein. Die Pflege der Daten erfordert Zeit, die im hektischen Praxisalltag zulasten des Patienten gehen kann.
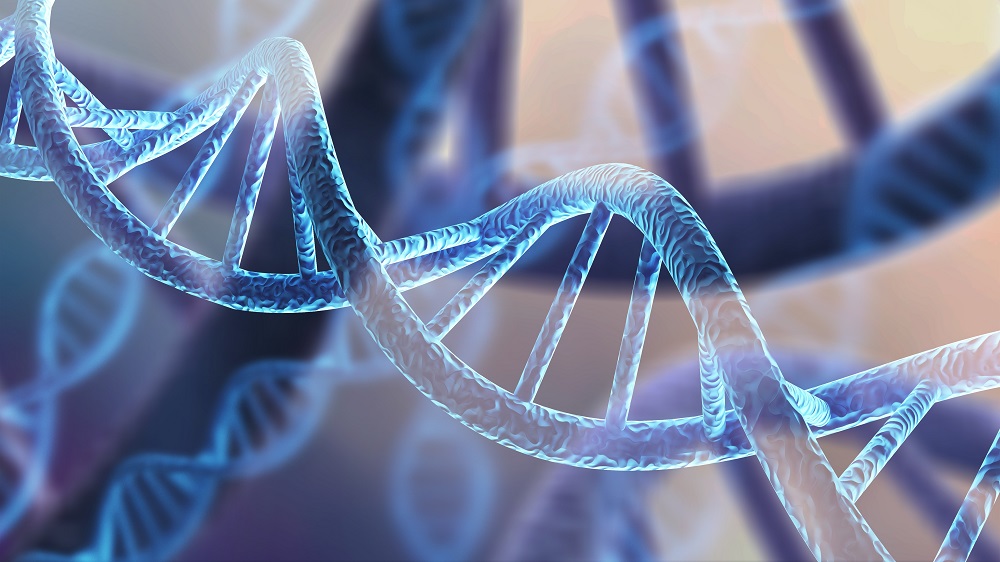
Für besonders sensible Gesundheitsdaten wie etwa zu sexuell übertragbaren Krankheiten oder Gendiagnostiken gelten strenge Informationspflichten – Ärzte müssen Patienten hier explizit auf das Widerspruchsrecht bezüglich einer Speicherung in der ePA hinweisen. Auch dieser Mehraufwand ist in der knappen Behandlungszeit erst einmal zu stemmen.
Kein Grund zur Eile: Die ePA gibt’s auch später noch
Ob die Vor- oder Nachteile der ePA überwiegen, muss jeder Versicherte für sich selbst entscheiden. Stand heute sind IT-Experten und Verbraucherverbänden zufolge noch einige Fragen im Hinblick auf die Datensicherheit und die Ausübung des Widerspruchsrechts offen. Auch könnten weniger digitalaffine Menschen beim so wichtigen Thema Gesundheit ins Hintertreffen geraten.
Informieren Sie sich am besten umfassend und bei verschiedenen Quellen über die elektronische Patientenakte, um sich ein möglichst vollständiges Bild zu machen. Die Informationen Ihrer Krankenkasse reichen dafür in aller Regel nicht aus. Lassen Sie sich von der Einspruchsfrist nicht unter Druck setzen: Sie können auch später noch jederzeit der ePA widersprechen oder nachträglich eine Digitalakte anlegen lassen.
Sie interessieren sich allgemein für Informationssicherheit im Internet? Lesen Sie unser Experteninterview zum Thema Datenschutz und Datensicherheit. Wenn Sie Fitness und Wohlbefinden gerne per Smartphone managen, stellen wir Ihnen 10 nützliche Gesundheits-Apps vor.
Bildnachweis:
Titelbild: stock.adobe.com/fizkes, Bild 2: stock.adobe.com/Aditya, Bild 3: stock.adobe.com/sosiukin, Bild 4: stock.adobe.com/BillionPhotos.com
Stille Post – unser Newsletter
Abonnieren Sie unseren Newsletter und bleiben Sie zu aktuellen Ratgebertexten, Produktneuheiten, Rabatten oder Unternehmens-Highlights auf dem Laufenden. In unserem Online-Magazin veröffentlichen wir regelmäßig neue Beiträge in den Bereichen „Auto & Mobilität“, „Freizeit & Reisen“, „Recht und Eigentum“ sowie „Leben & Gesundheit“.
Stille Post – unser Newsletter
Abonnieren Sie unseren Newsletter und bleiben Sie zu aktuellen Ratgebertexten, Produktneuheiten, Rabatten oder Unternehmens-Highlights auf dem Laufenden. In unserem Online-Magazin veröffentlichen wir regelmäßig neue Beiträge in den Bereichen „Auto & Mobilität“, „Freizeit & Reisen“, „Recht und Eigentum“ sowie „Leben & Gesundheit“.




